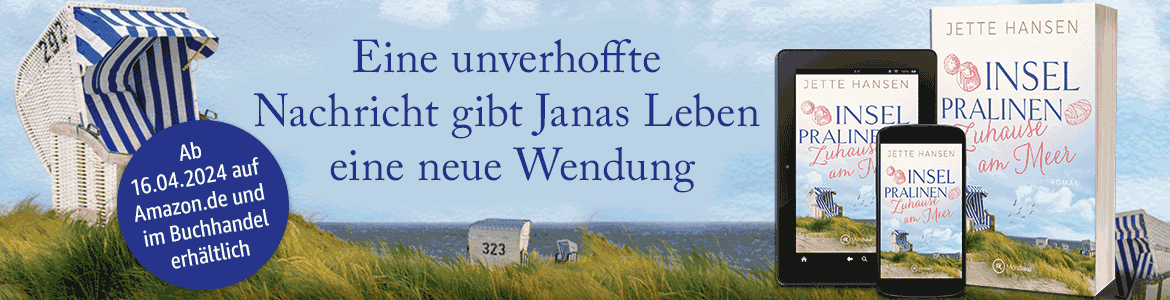Herr Fleischhauer, Ihr neuer Thriller „Das Meer“ erzählt von einer skrupellosen Fischereimafia, die über Leichen geht, um sich ihre Profite zu sichern. Gab es ein konkretes Erlebnis, das Sie veranlasste, dieses Thema in einem Thriller zu verarbeiten?
„Das Meer“ ist der dritte Teil einer Romanreihe über gesellschaftliche Fragen, die mir auf den Nägeln brennen. „Torso“, der erste Band, handelte von der unfasslichen Gier unserer sogenannten Eliten, dargestellt am Berliner Bankenskandal. In „Schweigend geht der Wald“ ging es um das schleichende Gift von Verdrängung. „Das Meer“ befasst sich erneut mit dem Thema Gier, allerdings nicht mehr am Beispiel der obszönen, krankhaft-asozialen Verhaltensmuster einer kleinen privilegierten Clique, sondern anhand der weltumspannenden Maschine aus Profit und Zerstörung, an der wir alle als Verbraucher zwangsläufig teilhaben – teils aus Unwissen, teils aus Bequemlichkeit, teils aus Resignation. Das Meer, beziehungsweise die legale und die illegale Fischereiindustrie, ist die Bühne, auf der unser kollektives Versagen beim Maßhalten im Umgang mit der Welt verhandelt wird, denn wir laufen gegenwärtig Gefahr, diese Welt buchstäblich zu Tode zu verbrauchen.
Im Stil der großen amerikanischen Thrillermeister umfasst Ihr Werk den gesamten Globus mit Schauplätzen in Südostasien, Europa und in Südamerika. Sie beschreiben das alles sehr genau – vom Luxushotel bis zum Flüchtlingscamp in Burma. Woher haben Sie all diese Details – hinreisen konnten Sie ja vermutlich nicht überall?
Als Thrillerautor sehe ich mich zwar nicht, aber soweit es irgendwie geht, suche ich die Schauplätze meiner Romane schon persönlich auf. Für „Schule der Lügen“ war ich zweimal sechs Wochen in Indien unterwegs, für „Drei Minuten mit der Wirklichkeit“ habe ich mich dreimal längere Zeit in Buenos Aires aufgehalten. Für die Recherchen für „Das Meer“ bin ich u.a. nach Rangoon gereist, und auf einer Reise in den Senegal habe ich gesehen, wie die von uns industriell leergefischten Küsten in Afrika aussehen und wie der kümmerliche Rest verarbeitet wird, der den Leuten bleibt.
Recherchereisen sind für Sie unverzichtbar?
Ja, und zwar ganz gleich, ob es um zeitgenössische oder historische Stoffe geht. Gerade jetzt war ich für mein nächstes Projekt im Medici-Archiv in Florenz und habe eine vierhundert Jahre alte diplomatische Geheimkorrespondenz samt Dechiffrierschlüssel ausgegraben, die ich ansatzweise aus Sekundärquellen schon kannte, aber noch nie im Original gesehen hatte. Meine Muse ist die Welt, bzw. manchmal auch das Archiv. Man findet da Dinge, die man sich im Traum nicht ausmalen könnte. Ich muss die Lebenswelt meiner Figuren kennen. Es würde mir schwerfallen, über eine Milonga oder einen indischen Ashram zu schreiben, ohne selbst jemals den Fuß dort hineingesetzt zu haben. Die Einbildungskraft kann viel leisten, aber die eigene Anschauung, die eigenen Gefühle und Eindrücke sind für mich unverzichtbar, um mich in meine Figuren hineindenken zu können.
Sie erzählen den Roman aus verschiedenen Perspektiven, u.a. aus jener der jungen Fischerei-Beobachterin Teresa, die spurlos von einem Fischfangschiff verschwindet; aus jener ihres Geliebten John Render in Brüssel; aus jener der Umweltaktivistin Ragna di Melo und aus der Sicht eines Schweizer Fischerei-Lobbyisten. Hatten Sie beim Schreiben einen Trick, um nicht den Überblick über die komplexe Handlung zu verlieren? Wie haben Sie das geschafft?
Wie ich im Nachwort angedeutet habe, zerfällt das Buch vor allem in zwei Erzählstränge- und perspektiven, die ich lange Zeit nicht verbinden konnte. Man könnte sagen: Der Roman (Adrian) und der Thriller (die Umweltaktivisten) kamen sich ständig in die Quere. Aber das ist bei fast all meinen Büchern der Fall. Ich sagte ja schon, dass ich mich nicht als Thriller- oder Krimi-Autor sehe.
Einen reinen Genre-Roman wollen Sie nicht schreiben?
Nein, aber „Literatur pur“ ist auch nicht mein Ding. Die Einzelperspektive der literarischen Form wird mir irgendwann immer zu klein, zu privat; die Totalperspektive des historischen Romans, des Thrillers oder Krimis hingegen ist mir zu groß und vor allem zu äußerlich. Meiner Ansicht nach braucht eine gute Geschichte von beidem etwas.
Sie haben also die Formen vermischt.
Und zwar von Anfang an: schon in meinem ersten Roman, der von der Form her ein Palimpsest ist, ein Pastiche. Es gibt leider kein deutsches Wort für diese Verfahren, wo man etwas Bestehendes nimmt und etwas Neues darüberlegt oder bekannte Elemente neu zusammenmontiert. Ich bin ein großer Fan des postmodernen Romans, der diese Verfahren zunächst experimentell, für ein kleines Lesepublikum, in die Literatur eingeführt hat. Jetzt ist, glaube ich, die Zeit gekommen, da diese hybriden Erzählformen von einem größeren Publikum nicht nur verstanden, sondern sogar gefordert werden, weil die eigene Lebenserfahrung nun auch dort angekommen ist.
Die Welt fügt sich nicht mehr in die alten Muster?
Ja, das Reale und das Imaginäre vermischen sich mehr und mehr. Wir leben längst in einer Art Hyperrealität, die Jean Beaudrillard vor vierzig Jahren prophezeit hat. Daher wäre es seltsam für mich, beim Schreiben so zu tun, als sei alles wie früher. Ich muss das mitdenken und es findet seinen Niederschlag unter anderem in der Suche nach neuen Formen.
Stimmen die Fakten in „Das Meer“ alle – oder anders gefragt: Wieviel Fiktion, wieviel Wirklichkeit steckt in Ihrem Roman?
Ich schreibe Faction, also eine Mischung aus Fact und Fiction. Wie oben beschrieben, gehe ich in die Welt bzw. ins Archiv, finde meine Inspiration dort und bin selbstverständlich bemüht, keine sachlichen Fehler zu machen. Aber ein Roman ist kein Sachbuch. Die Fakten sollten stimmen, vor allem wenn sie in der Auseinandersetzung zwischen den Figuren eine zentrale Rolle spielen. Aber die zentrale Frage ist nicht, ob irgendein Detail real oder plausibel erfunden ist, sondern immer nur der Werte-Konflikt zwischen den handelnden Figuren.
Apropos Werte. Was stellt für Sie ein Roman oder eine Erzählung in dieser Hinsicht dar?
Eine Erzählung oder ein Roman sind für mich immer eine moralische Unternehmung (keine moralisierende!), ein Glaubenskampf (kein Religionskrieg!), eine Sinnstiftung mit erzählerischen Mitteln. Es geht immer um Gut und Böse, richtig und falsch, Wahrheit und Lüge. Die Fakten oder Tatsachen müssen soweit stimmen, dass sie vom eigentlichen Duell der Wahrheiten, bei dem wir mitfiebern, nicht ablenken und dieses völlig unglaubwürdig machen. Ob die Tatsachen aus der Wirklichkeit entnommen werden oder komplett erfunden sind wie etwa im Science-Fiction oder Fantasy Genre, ist dabei völlig gleichgültig. Die erzählte Welt muss kohärent und stimmig sein und als optimale Bühne für den Konflikt der Wahrheiten und Vorstellungen zwischen den Figuren taugen.
Würde die echte Fischereimafia so weit gehen, Menschen zu töten?
Warum stellen Sie die Frage im Konjunktiv? Es sind bereits Fischereibeobachter ermordet worden und der jüngste Fall von Keith Davis, der während eines Umlade-Manövers im Pazifik von einem Trawler „verschwand“, wird nicht der letzte ungeklärte „Unfall“ gewesen sein.
Das wusste ich nicht.
Die Arbeitsbedingungen auf manchen thailändischen Trawlern kann man nur als Sklaverei bezeichnen. Auf diesen Fischerei-Galeeren gibt es viele ungeklärte Todesfälle. In der Thunfisch-Fischerei im Pazifischen Ozean herrscht totale Anarchie, man kämpft dort mit Wild-West-Methoden. Der Begriff „Mafia“ ist hier übrigens ein wenig irreführend, denn industrielle Fischerei wird ja von Staaten genehmigt und subventioniert und nicht nur von irgendwelchen Dunkelmännern des organisierten Verbrechens betrieben.
Viele Facetten des legalen Fischfangs kommen einem Verbrechen an der Natur gleich.
Genau. Trotz aller Warnungen von Wissenschaftlern werde viel zu hohe Fischereiquoten festgesetzt und auch noch zwischen den großen Fischereinationen gehandelt, was unter anderem dazu führt, dass in armen Ländern die Bevölkerung kaum noch etwas fängt, weil die Regierung dort die Quoten verkauft hat, die ausländische Mega-Trawler mit ihren gigantischen Netzen in kürzester Zeit abfischen. Die Beifang-Problematik, dass also für ein Kilo Speisefisch im Durchschnitt acht bis zehn Kilo „Biomasse“ vernichtet werden, kann man kaum anders denn als Ausrottungsprogramm bezeichnen. Darüber hinaus gibt es dann auch noch die sogenannte illegale Fischerei, die das Problem verschlimmert. Das ist ja das Problem: die Grenzen zwischen verbrecherisch agierenden Unternehmen, Regierungskriminalität, -versagen oder -komplizenschaft und organisiertem Verbrechen verwischen sich mehr und mehr.
In „Das Meer“ riskieren Ökoaktivisten den Tod vieler Verbraucher, um den Menschen das Fischessen zu vermiesen. Was Sie da beschreiben, ist aber hoffentlich ein Horrorszenario, oder?
In meinem Szenario wird kein einziger Mensch getötet. Eine Ciguatera-Vergiftung mit dem genetisch veränderten Algentoxin meiner „Öko-Terroristen“ ist nicht lebensbedrohlich. Allerdings erzeugt sie, wie das reale Algengift, Übelkeit und danach eine lebenslange Unverträglichkeit für Fischprodukte. Meine fiktiven Ökoaktivisten bringen also niemanden um, sondern sie errichten durch ihren Sabotageakt eine unüberwindbare biologische Schranke. Fischereierzeugnisse werden auf raffinierte Weise vergällt, sodass sie für Homo Sapiens ungenießbar werden.
Was halten Sie von der heutigen industriellen Fischerei und Fischzucht?
In der gegenwärtigen Form und Größenordnung sind die industrielle Fischerei und -zucht sowohl ökonomisch als auch ökologisch betrachtet völlig absurd, nicht viel anders als die industrielle Fleisch- oder Geflügelindustrie. Das Horrorszenario steht nicht in meinem Roman, sondern in unseren Kühlschränken und Tiefkühltruhen. Der Horror ist der Status Quo, die Unterjochung eines ganzen Planeten unter die zunehmend zweifelhaften Ernährungsbedürfnisse einer einzigen Art: Homo Sapiens.
Neben Ihrer schriftstellerischen Arbeit sind Sie auch Konferenzdolmetscher. Inwieweit spielten die Erfahrungen und Kontakte, die Sie durch Ihre Arbeit erlangen konnten, bei der Abfassung von „Das Meer“ eine Rolle?
Jeder aufmerksame Zeitungsleser oder Nutzer des Internet kann heute ebenso gut informiert sein wie die Leute, die sich beruflich mit Umweltproblemen befassen. Die Problematik ist derart präsent, dass ich lange gezögert habe, auch noch einen Roman darüber zu schreiben. Im Übrigen ist es ja nicht so, dass man als Dolmetscher ständig mit Staatsgeheimnissen zu tun hätte. Das ist so ein beliebter Mythos, der sehr wenig mit der Realität zu tun hat. Oft wissen die Journalisten in der Pressekonferenz schon mehr als ich, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Sitzung gedolmetscht hat. Sicher bringt der Beruf mit sich, dass man häufiger oder bisweilen etwas früher mit Problemen und Herausforderungen konfrontiert wird, die sich weltweit stellen. Aber das eigentlich Geheimnisvolle ist doch nicht, was unsere Volksvertreter und Sachverständige hinter verschlossenen Türen besprechen, sondern vielmehr die Frage, warum wir alle ständig wider besseres Wissen handeln. Wir alle!
Eine Ihrer Hauptfiguren ist auch Dolmetscher. Adrian gerät ins Epizentrum der Geschichte, weil er mit der verschwundenen Ragna vor Jahren eine Affäre hatte. Wieviel Wolfram Fleischhauer steckt in Adrian? Was mögen Sie an ihm und was nicht so sehr?
Als Romanfigur mochte ich ihn lange Zeit überhaupt nicht. Erstens, weil jeder denken wird, er sei mein Alter Ego, zweitens, weil die Figur des Dolmetschers einfach sehr klischeebeladen ist. Ich kenne keinen Roman oder Film, wo diese Figur mich überzeugt hätte.
Wie gingen Sie damit um?
Ich versuchte und versuche, mich als Autor in meinen Romanen aufzulösen wie eine Spinne, die in dem Netz verschwindet, das sie spinnt. Das Werk ist alles, der Autor ist nichts, beziehungsweise er ist auch nur eine Fiktion. In diesem Roman brauchte ich aber einen Zeugen, eine Figur, die die ganzen Vorgänge konzentriert spiegelt, eine Art Brennglas für die verschiedenen Perspektiven. In Adrian stecke aber letztlich nicht ich als Person oder als Autor, sondern jemand ganz anderes, wichtigeres: die Leserin! Der Leser! Adrian ist dazu da, eine Art Selbstgespräch im Kopf des Lesers in Gang zu setzen, das nach der Romanlektüre hoffentlich nicht abbricht, sondern weitergeht. Es geht weder um mich, noch um Adrian oder irgendwelche Aktivisten. Es geht um uns alle, um jeden einzelnen! Wie Ragna so schön sagt: It’s the consumer, stupid!
Sind Sie selbst als Dolmetscher auch schon einmal in brisante Situationen geraten? Wie war das?
Das kommt darauf an, wie man „brisant“ definiert. In sogenannten Konfliktzonen oder Krisengebieten habe ich bisher noch nicht gearbeitet, auch nicht bei Strafprozessen gegen Kriegsverbrecher oder so etwas. Einmal habe ich im Rahmen von Ermittlungen zu einem Mordfall Verhöre gedolmetscht, wo es recht unappetitlich wurde. Aber das meiste Adrenalin schüttet man bei diesem Job eher bei einer Anhörung zu Kartellrecht oder in einer wissenschaftlichen Konferenz über Olivenöl aus, wenn man fachlich schnell überfordert ist. Wettbewerbsrecht ist wie ein Krimi, aber terminologisch ein Alptraum. Dagegen sind Tatortfotos und ein Kreuzverhör ein Spaziergang.
Kann es Ihnen auch passieren – so wie es Ihrem Helden Adrian passiert –, dass Sie von einem Tag auf den anderen für viel Geld ans andere Ende der Welt fliegen müssen?
Bei mir kommt das selten vor, da ich vor allem in Brüssel dolmetsche. Meine Sprachkombination ist für Einsätze am Ende der Welt eher selten gefragt und es gibt nicht so viele Dolmetscher mit Muttersprache Deutsch, die auf dem ganzen Planeten herumtingeln. Das ist bei Englisch, Französisch, Russisch oder Arabisch schon anders und meine Frau, die in der französischen Kabine arbeitet, kommt erheblich mehr herum als ich. Diese Reiserei ist aber auch eine zweischneidige Sache, und ich bin gar nicht so unglücklich, dass ich nicht plötzlich nach China, an die Elfenbeinküste oder nach Südafrika fliegen muss. Das ist letztlich Geschmacksache.
Sie kommen also ganz gut klar damit, in Brüssel zu dolmetschen …
… anstatt mit Jetlag und verdorbenem Magen in Accra oder Neu-Delhi? Ja. Absolut! Meinen Kick bekomme ich eher bei Recherchereisen, denn da muss ich keine Entschließungen oder Erklärungen dolmetschen, sondern treffe interessante Leute, interviewe Fachleute für mein jeweiliges Thema, habe ausreichend Zeit für das Land oder die Region, die mich interessiert, und muss nicht in vier oder fünf Tagen nach Peking oder Rio und zurück.
„Das Meer“ ist nicht nur spannend, es ist auch ein Öko-Thriller, der aufrüttelt. Haben Sie aufgrund der Dinge, die Sie im Rahmen Ihrer Recherchen herausgefunden haben, Ihr Konsumverhalten oder sonst etwas in Ihrem Leben verändert?
Ein Pangasiusfilet oder ein Stück Viktoriabarsch käme nie in meinen Einkaufswagen. Fleischkonsum ist bei uns stark reduziert und ich bin sehr neugierig, wie es mit der veganen Revolution weitergeht. Aber wie Adorno gesagt hat, gibt es kein wahres Leben im Falschen, und ein geändertes Konsumverhalten einer kleinen Minderheit kann die Probleme leider nicht lösen. Darüber hinaus befinden wir uns in so endlos vielen Abhängigkeiten, dass es eine Illusion ist zu glauben, man könne auf einen Schlag wieder in den Stand der Unschuld zurückfallen. Ich will es mal so sagen: Wäre ich Lebensmittelchemiker, würde ich sicher an der veganen Revolution forschen.
Aber Sie sind nun mal Erzähler.
Ja. Deshalb sehe ich meine Aufgabe auch darin, dabei mitzuhelfen, unser gesellschaftliches Narrativ umzuschreiben, damit wir nicht z.B. die Zukunft unserer Kinder verspeisen. Jeder muss nach seinen Fähigkeiten versuchen, die Welt besser zu machen. Der unsägliche Raubbau an der Natur, insbesondere unter der Meeresoberfläche, wo keine Fernsehkameras laufen und selten Umwelt-Journalisten unterwegs sind, muss gestoppt werden. Wenn mein Roman dazu einen kleinen Beitrag leistet, bin ich schon froh. Man kann so unendlich viel tun, der menschliche Erfindungsgeist ist grenzenlos und ich habe gar keinen Zweifel, dass die nächsten Generationen Wege finden werden, finden müssen, diese fatale Spirale aus Wachstum und Zerstörung zu stoppen. Der Verbraucher spielt dabei eine zentrale Rolle, daher mein Versuch, in Romanform das Bewusstsein dafür zu schärfen.
Ihr Thriller ist auch eine Liebesgeschichte. Könnten Sie – ohne zu viel zu verraten – andeuten, in welchem Spannungsfeld sich diese Liebe abspielt?
Adrian und Ragna bringen die Frage des Romans auf den Punkt: Wie soll man das Wahre im Falschen leben, wie kann man das private Glück und das gesellschaftliche Unglück aushalten, ohne an diesem Widerspruch irre zu werden?
Die beiden kennen sich aus der Schulzeit und schon damals zerbricht ihre Liebesbeziehung, weil Adrian vor Ragnas Radikalität zurückschreckt.
Sie will nach der Ermordung nigerianischer Menschenrechtler, die sich mit friedlichen Mitteln gegen Shells gewissenlose Umweltzerstörung aufgelehnt hatten, eine Tankstelle anzünden. Adrian „entführt“ sie, um ihre Teilnahme an der Aktion zu verhindern. Ragna entgeht dadurch zwar einer Gefängnisstrafe, aber sie kann Adrian nicht verzeihen und bricht den Kontakt zu ihm ab.
Jahre später wiederholt sich diese Situation auf der ganz großen Bühne.
Wieder ist es Adrian, der Ragna davor bewahren will, sich für eine aussichtslose Sache zu opfern, wird diesmal allerdings unwissentlich von Ragnas Vater benutzt und gerät dadurch in ein noch größeres Dilemma. Für Ragna ist das kleine Glück im großen Unglück unvorstellbar. Für Adrian ist es genau umgekehrt.
So spiegelt diese unmögliche Liebesbeziehung die gesellschaftliche Frage des Romans im Schicksal zweier Menschen.
Ja, in diesen beiden Figuren treffen sich zwei Sehnsüchte, die vermutlich in jedem von uns einander suchen, Kopf und Herz vielleicht, die eine Seele werden wollen. Aber das ist so unendlich schwierig …