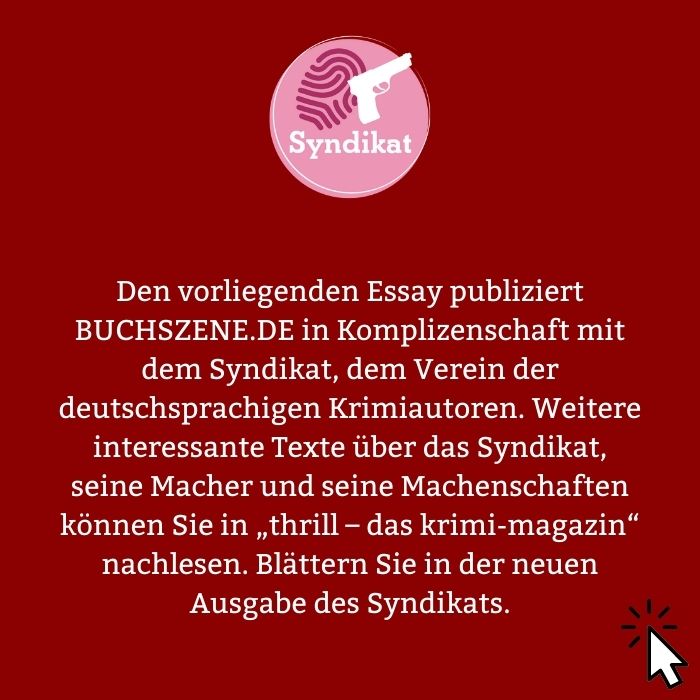Die Wahrheit ist immer noch schlimmer
Als Krimiautorin begehe ich im Kopf brutale Morde und löse sie dann gleich selbst. Ich fühle mich dabei zuweilen ein bisschen wie eine gespaltene Persönlichkeit. In meinem neuesten Roman „Bis er gesteht“ jedoch gehe ich zurück zu meinen Wurzeln als Gerichtsreporterin: Es handelt sich um eine literarische Nacherzählung eines wahren Kindermordes.
Ich habe einen eigenartigen Beruf. Zum Rüstzeug, das ich als Krimiautorin benötige, gehören eine morbide Ader, eine überbordende Fantasie, eine tendenziell gespaltene Persönlichkeit, eine gehörige Portion Größenwahn und eine Faszination für das Böse. Ich verdiene mein Geld, indem ich in meinem Kopf ausgeklügelte Verbrechen oder gar brutale Morde begehe und sie dann auch gleich selbst löse. Ich schlüpfe in die Rolle von Personen, die es gar nicht gibt, die ich selbst erfunden habe, und springe beim Schreiben wortwörtlich ständig von einer fiktiven Figur in die andere.
So stecke ich beispielsweise auf Seite 20 im Kopf des von mir erschaffenen Mörders und begehe auf möglichst clevere Art und Weise einen hinterhältigen Mord, vorsichtig darauf bedacht, dass mir keiner auf die Schliche kommt. Auf Seite 40 wiederum schlüpfe ich in die Figur des Polizisten, der am Tatort eintrifft und keine Ahnung hat, wer dieses Blutbad angerichtet hat. Er will den Kerl um jeden Preis erwischen – obwohl im Täter derselbe Mensch steckt wie im Polizisten selbst, nämlich ich.
Wenn mir eine von mir ausgedachte Person auf die Nerven geht, kann ich sie mit ein paar Sätzen um die Ecke bringen – oder ich mache sie zum Mörder und lasse sie auffliegen und im Gefängnis landen. Ich kann völlig frei entscheiden, wer gut ist und wer böse, wer überlebt und wer stirbt. In meiner Geschichte bin ich das Schicksal, das über alles bestimmt, und das ist mitunter ein großes Vergnügen.
Dabei lege ich eine nicht unerhebliche kriminelle Energie an den Tag. Damit mir das Morden im Kopf möglichst glaubwürdig gelingt, gehe ich so vor, wie auch ein Mörder vorgehen würde: Ich bereite mich seriös auf die Tat vor. Tatsächlich bin ich überrascht, dass ich nicht längst verhaftet worden bin, zum Beispiel wegen „strafbarer Vorbereitungshandlungen“ zu Mord, was mir eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren einbringen könnte.
Würde die Überwachung der E-Mails und der Telefone so funktionieren, wie es sich manche unserer Politiker wünschen, hätten längst zwei Polizisten vor meiner Tür gestanden und freundlich, aber bestimmt gesagt: „Frau Brand, könnten Sie bitte mitkommen?“ Würde die Polizei meinen Laptop beschlagnahmen, würde sie feststellen, dass ich mir in den letzten Monaten die Finger wundgegoogelt habe mit Sucheingaben wie: „Mord, der aussieht wie Suizid“, „Suizid, der aussieht wie Mord“, „Mord durch Aufhängen an den Füßen“ oder „Wie mache ich eine Leiche unidentifizierbar?“.
Auch mein reger Nachrichtenaustauch mit Kriminalexperten macht mich höchst verdächtig: Weil das Internet mit meinen Fragen oft überfordert ist, habe ich mir Freunde zugelegt, die es besser wissen. Meine Lieblingshelfer sind ein Fahnder und ein Rechtsmediziner. Sie decken mich ein mit weisen Ratschlägen, mit Fachliteratur und realen Bildern zum Thema – die Art von Fotos, bei denen ich reflexartig den Laptop zuklappe, wenn ich die E-Mail ungeschickterweise in einem Café öffne. Ich habe bei meinen Recherchen als Krimiautorin gelernt, wie man aus der Thujahecke im Nachbarsgarten einen tödlichen Giftcocktail herstellen kann, der ein brutales Sterben verspricht. Und ich weiß dank dem Rat zweier Mediziner, wie der nahezu perfekte Mord aussieht. Was ich an dieser Stelle natürlich nicht verrate.
Gut möglich, dass Sie nun denken, ich sei kein netter Mensch. Ich sei nicht nur morbide, in mir schlage gar ein kaltes Mörderinnenherz. Tatsächlich wäre ich nicht die erste Krimiautorin, die es nicht beim Morden im Kopf belässt, sondern auch im realen Leben zur Waffe greift. Die US-Autorin Nancy Crampton-Brophy etwa publizierte eine Glosse mit dem Titel „Wie man seinen Mann ermordet“ – jetzt ist sie wegen Mordes angeklagt, weil sie ihren Gatten umgebracht haben soll.
Im Zweifel für die Angeklagten lässt sich aber sagen: Kriminelle Krimiautoren sind die Ausnahme. Was mich selbst anbelangt, kann ich Ihnen versichern: Obwohl ich mir bereits zahllose Morde ausgedacht habe, werde ich mein Bestes tun, meine mörderischen Pläne im realen Leben nie in die Tat umzusetzen. Tatsächlich bin ich nämlich ein friedliebender Mensch. Manche nennen mich gar ein sonniges Gemüt. Ich bin im Streiten gänzlich unbegabt und kann wortwörtlich keiner Fliege etwas zuleide tun. Einzig die Sache mit der morbiden Ader kann ich nicht abstreiten, in diesem Punkt bekenne ich mich schuldig.
Allerdings plädiere ich auf mildernde Umstände, denn zu meiner Verteidigung kann ich anführen, dass die Veranlagung familiär bedingt ist: Mein Vater war Bestatter. Doch allein mit der Berufswahl meines Vaters lässt sich meine Faszination für das Böse nicht erklären. Woher sie kommt, ist schwierig zu eruieren. Womöglich haben mich die schrecklichen Verbrechen in den 1980er Jahren geprägt, als in der Schweiz etliche Kinder verschwanden und manche tot und andere nie mehr gefunden worden sind. Ich erinnere mich, wie ich als Dreikäsehoch in die Gesichter auf den Vermisstenanzeigen blickte – lachende Kinder so alt wie ich – die von einer auf die andere Sekunde spurlos verschwunden waren.
Das war für meinen Kinderkopf verstörend, unfassbar und faszinierend zugleich; dass etwas sein konnte, das nicht sein durfte in einer heilen Welt. Die wahren Verbrechen um die verschwundenen Kinder wurden mir denn auch zur Inspiration für meinen im April 2021 erschienenen Thriller „Der Bruder“. Oder aber ich wurde als Jugendliche durch den Mord in der Berner Gemeinde Kehrsatz „kriminalisiert“. Der Fall war in Bern ein mediales Dauerthema und teilte die Gesellschaft in zwei Lager: Die einen, die an die Unschuld des verhafteten Ehemanns des Opfers glaubten, und die anderen, für die er der Täter war.
Es war der erste Kriminalfall, bei dem ich im Gerichtsaal saß, während ich die Schule schwänzte. Noch ahnte ich nicht, dass ich fast dreißig Jahre meines Lebens als Kriminalreporterin unterwegs sein würde. Heute kann ich nicht mehr zählen, wie viele Gerichtsprozesse ich mitverfolgt habe, wie vielen Mördern ich begegnet bin. Zweifelsohne ist mir meine Erfahrung als Gerichtsreporterin beim Schreiben von Krimis von großem Nutzen. Fast jeder meiner Romane ist entweder durch einen wahren Kriminalfall inspiriert oder ein reales Verbrechen fließt als Nebenfall in das Buch ein.
Mit meinem neuesten Roman „Bis er gesteht“ gehe ich noch einen Schritt weiter – oder eher: Einen Schritt zurück, zurück zu meinen Wurzeln als Gerichtsreporterin. Ich habe die Geschichte nämlich nicht frei erfunden – es handelt sich vielmehr um eine literarische Nacherzählung eines wahren Kindermordes, niedergeschrieben in der Form eines Kammerspiels: Der Roman besteht ausschließlich aus Zeugenaussagen und den Befragungen des Beschuldigten, die zu einem großen Teil auf realen Protokollen basieren.
Ich möchte damit dem Leser ein Gefühl vermitteln, das ich als Reporterin im Gerichtsaal erfahren habe – das Hin- und Her-Gerissen sein, wenn man den Zeugen zuhört, der Anklage, der Verteidigung und dem Täter.
Im Gerichtssaal prallen Welten aufeinander. Hier kreuzen sich die Lebenswege unterschiedlichster Menschen. Im Publikum sitzen Angehörige von Opfern neben Angehörigen von Tätern. Vorne nehmen die Angeklagten Platz, schräg hinter ihnen sitzen ihre Opfer, falls sie überlebt haben, oder die Hinterbliebenen mit ihren Anwälten. Täter, Opfer, Angehörige – Menschen in Ausnahmesituationen. Schwere Delikte, tragische Schicksale haben sie in diesem Moment an diesem Ort zusammengeführt, um das Geschehene zu rekapitulieren und das Unfassbare zumindest juristisch fassbar zu machen. Verteidiger und Staatsanwälte werfen sich Paragrafen um die Ohren, sie schildern das Delikt mal aus der einen, mal aus der anderen Perspektive, wobei sich die Geschichten selten gleichen. Es ist die Aufgabe des Richters, nach der Wahrheit zu suchen – obwohl es in den meisten Fällen die eine absolute Wahrheit gar nicht gibt.
Der Fall, der meinem neuen Roman „Bis er gesteht“ zu Grunde liegt, ist ein besonders schweres Verbrechen, in dem die Wahrheitssuche ausgesprochen schwierig war.
„Ich werde Ihnen Antworten geben. Ich werde Ihre Fragen nach dem Was und dem Wer beantworten können, ohne dass erhebliche Zweifel bleiben. Etwas anders sieht es aus bei der Frage nach dem Warum. Es handelt sich hier um einen unbegreiflichen Fall. Es geht um zwei Verbrechen, die kaum jemanden unberührt lassen. Auch an mir ist diese Untersuchung nicht emotionslos vorbeigegangen.“
Mit diesen Worten eröffnete der Zürcher Staatsanwalt Markus Oertle sein Plädoyer vor dem Zürcher Geschworenengericht, in dem es um den Fall um zwei im Schlaf erstickte Kinder ging. Ich saß damals als Justizreporterin für die NZZ am Sonntag im Gerichtssaal, um über den Fall zu berichten. So, wie ich es zahllose Male zuvor schon getan hatte und viele weitere Male danach wieder tun sollte. Doch der Mord an den beiden Kindern, auf dem der Tatsachenroman basiert, ist einer jener Fälle, die für immer haften bleiben. Zum einen, weil die Tat nicht verstanden werden kann; der Fall überschreitet die Grenze des Fassbaren. Zum anderen, weil dieser Mordprozess als einer der letzten vor einem Schweizer Geschworenengericht verhandelt worden ist, bevor diese Form der Rechtsfindung abgeschafft wurde.
Der Prozess zum Mord an den beiden Kindern begann mit dem Notruf: Die Aufnahme des Telefonats, in dem der Vater die Polizei um Hilfe rief, nachdem er seine beiden Kinder getötet aufgefunden hatte, lief im Gerichtsaal vom Tonband. Damit sich die Geschworenen ein Bild machen konnten, wurden Tatortfotos – der Junge und das Mädchen tot in ihren Betten – auf Großleinwand projiziert. Nicht nur die Mutter und der Vater, auch der Rechtsmediziner, der Kriminaltechniker, die Nachbarinnen, die Liebhaber, die ermittelnden Polizisten, die Frauenärztin, Verwandte, der forensische Psychiater und einige mehr wurden vorgeladen und vom Gerichtspräsidenten vor den Geschworenen befragt. Der Prozess dauerte fast drei Wochen, meine Notizen füllten mehrere Schreibblöcke, die die Grundlage für diesen Roman bildeten.
Es handelt sich bei „Bis er gesteht“ aber nicht um eine lange, journalistische Reportage. Der Fall wird ausschließlich mittels Aussagen wiedergegeben – Aussagen, die zum Teil genau so oder sinngemäß sehr ähnlich tatsächlich gemacht wurden. Der Telefonnotruf beispielweise ist eine beinahe wörtliche Abschrift des echten Notrufs. Die Gedanken und Erzählungen von Nachbarn, Experten oder Liebhabern stützen sich exakt auf die Angaben, die ebendiese vor Gericht gemacht haben. Andererseits habe ich einige Aussagen, die auf den realen Vorfällen basieren, frei formuliert. Auch die Einvernahmen des Vaters sind über weite Strecken fiktiv – sie basieren aber auf seinen Aussagen vor Gericht und stehen stets in Bezug zu den realen Geschehnissen jener folgenschweren Nacht.
„Bis er gesteht“ ist bestimmt kein einfacher Roman – es geht um zwei ermordete Kinder. Aber es ist die Realität, die diesen Fall hervorgebracht hat. Verbrechen unserer Zeit halten uns einen Spiegel vor und offenbaren schonungslos die Schattenseiten unserer Gesellschaft. Die Wirklichkeit, so scheint es mir, ist immer noch ein bisschen schlimmer als alles, was wir uns ausdenken mögen.
Mehr über Christine Brand
Mehr Werkstattberichte für Sie: