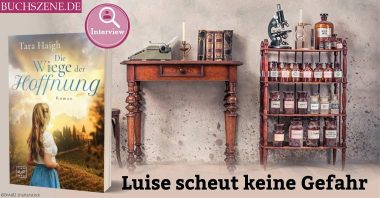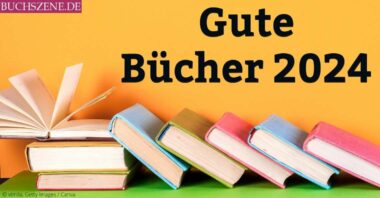Frau Haigh, mit Ihrem neuen Roman „Der Ruf des schwimmenden Gartens“ entführen Sie uns nach Madeira. Vermutlich ein malerischer Ort, sonst hätten Sie sich diesen Schauplatz nicht ausgesucht?
Madeira ist ein einziges lebendiges Landschaftsgemälde und wird nicht umsonst die Blumeninsel genannt. Ewiger Frühling, viel Sonne im Wechsel mit meist kurzen Regenschauern sind für die dortige Flora ein Paradies. Man nennt sie auch den schwimmenden Garten des Atlantiks – daher bezog ich meine Inspiration für den Buchtitel.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Ärztin Sofie, die im Jahr 1914 am Bremer Krankenhaus arbeitet. Allerdings wird sie von ihren männlichen Kollegen nicht respektiert. Doch dann hört sie von einer einmaligen Chance, die ihre Abenteuerlust weckt.
Sofie verdankt ihre hervorragende Ausbildung einem Studium in der Schweiz, die es Frauen bereits ab den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts ermöglichte, Medizin zu studieren. Die erste Schweizer Ärztin eröffnete 1874 ihre Praxis. Ein Jahr am Londoner St. Thomas Hospital rundete Sofies Ausbildung ab. Ihr Dilemma besteht darin, dass ihr die Kollegen das angeeignete Wissen neiden und sie sich sicher sein kann, dass ihr Aufstiegschancen in der von Männern dominierten Ärzteschaft verwehrt bleiben.
Doch dann erhält sie das Angebot, beim Aufbau einer Station im neuen deutschen Krankenhaus in Funchal auf Madeira von Anfang an mit dabei zu sein?
Genau, und zudem in ihrem Fachgebiet, der Pneumologie. Ihr Vater hat geschäftlich selbst Zeit auf Madeira verbracht, so dass ihr die Insel von seinen Erzählungen nicht fremd und ein Wagnis, dem Aufbruch in eine Welt jenseits der europäischen Metropolen wert ist.
Einer der Investoren ist der Kaufmann Richard Hauenstein. Was beeindruckt Sofie an ihm?
Richard ist ein Macher, der zudem mit einem schier unwiderstehlichen Angebot auf sie zukommt. Sie vertraut ihm, weil er der Sohn eines Freundes ihres Vaters ist. Während des harten Studiums und im ersten Berufsjahr in der Bremer Klinik hatte sie keine Zeit für ein Privatleben und ist daher dem charmanten und zugleich weltmännischen Mann nicht abgeneigt, doch nach und nach bröckelt die Fassade, als sie Madeira erreicht …
Was ihre Arbeit als Ärztin angeht, stellt Sofie fest, dass auf Madeira nicht alles so ist, wie man es ihr versprochen hat?
Sofie rechnet bei Ankunft auf der Insel damit, ein bereits fast fertiggestelltes Krankenhaus vorzufinden, bei dem sie ihre Expertise als Lungenfachärztin auch in Fragen der Organisation und der Behandlungsabläufe mit einbringen kann. Stattdessen steht sie vor einem sich teilweise noch im Rohbau befindlichen Gebäude. Immerhin zeigt man ihr auf dem Rathaus die Pläne und schätzt ihren Rat. Doch monatelang däumchendrehend auf der Insel zu verweilen, bis das Krankenhaus fertig ist und sich von Richard auch noch Avancen machen zu lassen, kommt für Sofie nicht in Frage.
Wie sind Sie auf die Idee zu diesem Roman gekommen? Da steckt vermutlich eine intensive Vorrecherche drin?
Ausnahmsweise diesmal nicht während einer Recherchereise für meine Komödien, die ich als Tessa Hennig schreibe. Ich stieß auf der Suche nach einer Romanidee für einen neuen historischen Roman rein zufällig auf ältere Rechercheunterlagen, die ich nach einer Madeira-Reise gesammelt hatte. Ein interessantes Setting. Dann suchte ich nach einem Bezug zur deutschen Geschichte, nach der „Perle“, die es sich zu erzählen lohnt. Und prompt fand ich sie. Ein deutsches Krankenhaus auf Madeira, das heute noch existiert. Einen Aspekt der Weltgeschichte zu erzählen, den die meisten nicht kennen, ist Öl in Taras Feuer, wie jeder weiß, der meine Romane kennt.
Sofie soll als Tuberkulose-Ärztin arbeiten. Wie wurde die Tuberkulose damals behandelt?
Es gab seinerzeit für die als Auszehrung bekannte Erkrankung noch keine Behandlungsmöglichkeit in Form einer Medikation, doch es war bekannt, dass Aufenthalte in einem warmen Seeklima, also in salzhaltiger Luft, und in der Sonne vielen Erkrankten Heilung versprachen. Bereits 1882 entdeckte der deutsche Epidemiologe Robert Koch den Erreger der Krankheit. Das von ihm entwickelte Gegenmittel Tuberkulin entpuppte sich jedoch als Fehlschlag. Es bildete fortan aber die Grundlage für einen Tuberkulosetest, den es ab 1907 auch in deutschen Kliniken gab.
Wie in Ihren anderen Romanen haben Sie für „Der Ruf des schwimmenden Gartens“ wieder ein reales historisches Setting entworfen. Madeira spielte seit Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich eine nicht ganz unspektakuläre Rolle für die Reichen Europas …
Madeira war in der Spielzeit des Romans in englischer Hand. Dennoch kam der gesamte europäische Finanzadel, um die Heilkraft der Insel wissend – auch Deutsche, die den Engländern diesen Platz an der Sonne im kolonialen Wettstreit natürlich neideten. Geld regiert bekanntlich die Welt, was eine Gruppe von deutschen Patrioten auf den verwegenen Gedanken brachte, die Insel durch die Hintertür doch noch an sich zu reißen.
Das Krankenhaus, in dem Sofie arbeitet, gab es wirklich. Allerdings haben die Deutschen seinerzeit getrickst. Es ging ihnen gar nicht um die Medizin?
Die Deutschen köderten die Inselregierung mit dem Bau eines Sanatoriums und von Krankenhäusern, in denen im Gegenzug für Steuererleichterungen und die Zusicherung, dass sie unter deutscher Leitung stehen würden, vierzig Tuberkulosepatienten pro Jahr kostenlos behandelt werden sollten. Doch wurden diese Pläne als Projekt für Ferienanlagen entlarvt – für die Reichen. Bei einem Konzessionsentzug blieb es nicht, als die Behörden eine folgenschwere Entdeckung machten …
Zurück zu Sofie: Eines Tages lernt sie, die von Richard enttäuscht ist, dessen Bruder kennen. Ludwig hat eine Ausstrahlung, die Sofie für ihn einnimmt. Was ist er für ein Mensch?
Ludwig ist das genaue Gegenteil von Richard. Er ist ein Träumer und Romancier, für den es die große Liebe aber nur in seinen Romanen gibt. Er ist humorvoll, beredt und ein Weltenbummler, der sich nicht davor scheut, Zeit bei einem afrikanischen Stamm zu verbringen, um seinen Horizont zu erweitern. Seine, für einen Mann der damaligen Zeit, unkonventionelle Art hinterlässt mehr Eindruck bei Sofie als Ludwigs Bruder recht ist, zumal er Sofie auch noch zur Seite steht, als sie in ein Wespennest aus Lügen und Korruption sticht.
Wird Sofie auf Madeira bleiben und als Ärztin arbeiten?
Sofies Verbleib auf der Insel und die Frage, jemals in dem deutschen Krankenhaus zu arbeiten, hängt davon ab, ob es ihr gelingt, eine Schlangengrube auszuheben. Den Schlüssel dazu gibt ihr ausgerechnet ein kleiner Waisenjunge an die Hand, der sie nicht nur auf die Spur eines erschütternden Geheimnisses bringt, sondern auch in die Lage versetzt, den Kampf gegen Korruption, imperiales Machtstreben, aber auch für eine große Liebe aufzunehmen.
Gibt es heute noch Spuren auf Madeira, die von den historischen Ereignissen zeugen, vor deren Hintergrund Sie Ihren Roman erzählen?
Das damals von den Deutschen zum Teil errichtete und nach dem ersten Weltkrieg von den Madeirern fertiggestellte Krankenhaus namens „Marmeleiros“ gibt es noch heute.
So wie wir Sie kennen, arbeiten Sie längst am nächsten Roman. Wollen Sie schon was verraten?
Im Moment arbeite ich als Tessa Hennig an einer turbulenten Komödie, die sich thematisch mit den Perspektiven des Alleinseins beschäftigt und in – surprise surprise – Bella Italia, diesmal in Umbrien, um genau zu sein, spielt. Für das historische Label habe ich deutsche Kolonialgeschichte im Blick. Zwei meiner absoluten Lieblingsfilme sind die spanischen Produktionen „Palmen im Schnee“ und “1898 – Our Last Men in the Philippines”. Ich möchte mich mal beim Schreiben von meinen Figuren in diese Zeit entführen lassen.