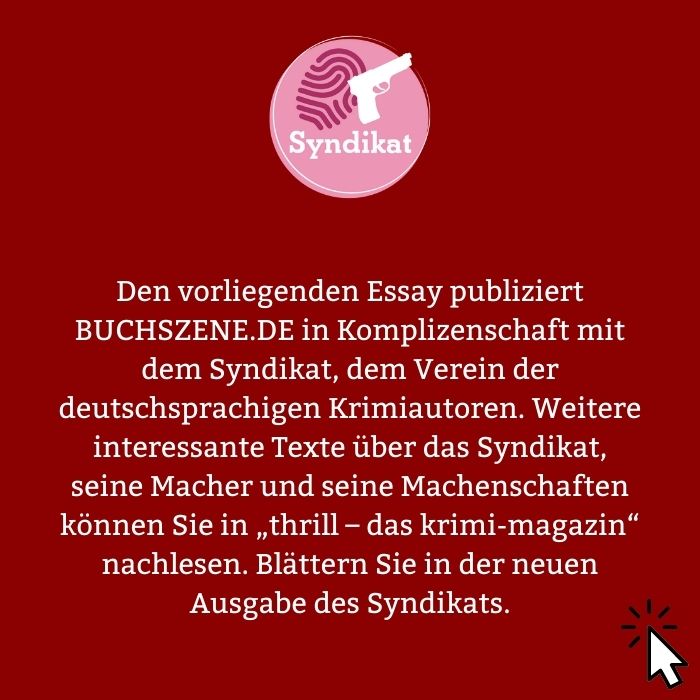Mitte Juli 2022: Vier Wochen bis zur Deadline
Mit der Erfahrung von drei Romanen im Rücken: Gegen Ende jedes Manuskripts besteht die Gefahr, dass mit der Geschichte etwas passiert, das man als Autor nicht eingeplant hatte. Selbst wenn man, wie in meinem Fall, alles bis zum Ende durchgeplottet und ein extrem ausführliches Exposé (Ü60 Seiten) verfasst hat. Auch wenn es sich nicht um einen Krimi/Thriller handelt, wie bei meinen drei Romanen davor, sondern um einen Unterhaltungsroman, einen Zeitreiseroman, einen Liebesroman, einen Abenteuerroman, einen Spannungsroman namens „1988“. Dessen Antagonist larger than life ist. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Person, sondern um ein Ereignis, und zwar die Flugtagkatastrophe von Ramstein 1988. Die wie ein Damoklesschwert über der Geschichte hängt. Auch wenn die Katastrophe in vielen Kapiteln kein offensichtliches Thema ist, so ist sie dennoch immer präsent und lauert unter der Oberfläche.
To cut a long story short: Ich befand mich auf der Zielgeraden, hatte noch knapp 60 bis 80 Seiten zu schreiben und wähnte mich safe. File under: trügerische Sicherheit. Denn dann tauchte sie auf. Das Gör. Eine als Nebenfigur angelegte Figur, die plötzlich vehement ins Spotlight drängte und Aufmerksamkeit forderte, die ihr ihrer Meinung nach zustand. Und dabei stampfte sie mit den Füßen, warf sich theatralisch auf den Rücken und kreischbrüllte wie Ian Gillan in seinen besten Zeiten.
Muss man als Schriftsteller dieses, tja, kindische Verhalten einer Nebenfigur ernst nehmen? Oder dem Gör einfach eine klare Ansage im Sinne von „Fuck you! Du bist nicht relevant!“ machen? Auch wenn das Gör eigentlich kein Gör, sondern eine Frau im Alter von 50 Jahren ist, die Elisabeth heißt, aber Lisa genannt werden möchte? Ja, Ansage machen, unbedingt!
Aber falls sie nach zwei Tagen immer noch stampft, brüllkreischt und wütet: ernst nehmen. Unbedingt. Weil: Ebenjene Lisa weiß viel mehr über den Fortgang der Geschichte und ihrer Rolle dabei, als der feine Herr Autor zu diesem Zeitpunkt auch nur ahnen kann. Es geht um Vertrauen. Seinen Figuren gegenüber. Denn die kennen sich besser – und vor allem viel länger – als der Autor sie zu kennen glaubt.
Trotz des Zeitdrucks denke ich deshalb die nächsten Tage ausschließlich darüber nach, welche Konsequenzen es für „1988“ hätte, wenn ich Lisa und ihre Geschichte schreiben würde. Was mir ziemlich schnell klar wird: Wenn ich ihr wirklich den erzählerischen Raum geben würde, den sie so vehement einfordert, dann wird der Roman über 400 Seiten lang. Was nicht weiter schlimm ist, denn diesbezüglich habe ich von meinem Verlag keine Vorgabe. Was aber ein richtiges Problem werden könnte: Die Geschichte wird ein neues Ende haben. Ein Ende, das komplett anders wäre als das Ende, das ich mir ausgedacht habe. Und von dem ich gehofft hatte, dass sich verdammt nochmal alle meine Figuren daran halten würden. Leider haben sich die Figuren in allen meinen Romanen eher selten an meine vermeintlich wohl durchdachten Plots und Vorgaben gehalten und stattdessen ein, tja, Eigenleben entwickelt. Und jedes Mal gab es endlose Diskussionen mit den kleinen Scheißern, die sich aber ums Verrecken nicht fügen wollten. Wobei ich in der Rückschau zugeben muss, dass sie immer die besseren Argumente hatten.
Im aktuellen Fall ändert Lisa aber wie erwähnt nicht nur einen kleinen Teil der Geschichte, sondern sie ändert das komplette letzte Drittel inklusive des Endes und des Epilogs. Weil: Sie steht mit allen anderen Figuren – und vor allem mit meinem Protagonisten – in enger Beziehung. Um nicht zu sagen in intimer Beziehung. Wenn ich Lisa jetzt Macht über die Geschichte geben würde, dann ändert sie dadurch natürlich auch das Schicksal aller Anderen. Was an sich ja okay wäre. Aber doch nicht vier Wochen vor der Deadline! Houston, ich habe ein Problem.
Und die ticking clock tickt unerbittlich. Sehr beliebt in Hollywood-Movies, in denen der Held/die Heldin/die Helden gegen Ende nur wenig Zeit haben, um die Welt zu retten/sich selbst zu retten/die Liebe ihres Lebens zu retten/eine Katastrophe zu verhindern/ein Monster zu besiegen – you name it. Dramaturgisch funktioniert das immer. Im echten Leben hingegen (davon ausgehend, dass das Leben eines Schriftstellers das echte Leben ist, was ich bezweifle) ist eine ticking clock eher kontraproduktiv. Dennoch werde ich nicht darum herumkommen, Lisas Story und das Ende meiner Geschichte neu zu denken. Aber dazu brauche ich Zeit. Die ich nicht habe. Weil: Wenn ich denke, kann ich nicht schreiben. Und wenn, dann nur rudimentär, aber ganz sicher nicht zwei bis drei Kapitel pro Tag. In meinem Fall war es schon immer so: 80 Prozent denken, 20 Prozent schreiben. Wenn ich eine Geschichte im Kopf zu Ende gedacht hatte, gestaltete sich das anschließende Schreiben immer als wahre Freude. Okay, let’s think.
Anfang August 2022: Zwei Wochen bis zur Deadline
Eine Woche zu Ende gedacht, eine Woche geschrieben. Und es fühlt sich absolut richtig an. Sowohl der neue Plot, den Lisa, das 50-Jährige Gör angestoßen hat, als auch das Ende. Ich spüre, dass der Erzählstrang mit ihr, der Ex-Nebenfigur, die jetzt eine Hauptfigur ist, funktionieren wird. Ebenso wie das Ende, das jetzt ein komplett anderes ist, aber ebenfalls funktioniert. Gefühlt sogar besser als das angedachte Ende. Fokussieren jetzt. Das Leben ausblenden und in einer Woche das Ding mithilfe von Hard-Rock-Vinylalben aus den 80ern zu Ende rocken.
Eine Woche bis zur Deadline
C’est fini! Fehlt nur noch der Epilog, den ich aber nachliefern kann, da mein Lektor erstmal vollauf mit den knapp 400 Seiten beschäftigt sein wird, die ich ihm die Tage zukommen lasse. Aber erst nachdem ich die für mich (und vermutlich auch für viele meiner Kollegen) anstrengendste Arbeit beendet habe: das interne Lektorat. Heißt: Alles von Anfang an lesen und die Notizen und Anmerkungen, die ich mir während des Schreibens gemacht habe, ins Manuskript einarbeiten. Wenn ich schreibe, habe ich weder die Zeit noch die Energie, mich darum zu kümmern. Was okay ist. Meine Arbeitsweise bei jedem Roman: Schreiben, schreiben, schreiben. Den flow mitnehmen, sich treiben lassen, sich verlieren und einfach nur, tja, die Geschichte erzählen. Überarbeiten, kürzen, anpassen erst dann, wenn ich ENDE – neben LOVE, LIFE und LIVE übrigens eins der schönsten Wörter mit vier Buchstaben – unter das Manuskript gesetzt habe.
File under: Write drunk, edit sober. Klingt nach Bukowski. Oder Hemingway. Wobei sich das allwissende Internet bezüglich des Schöpfers des Zitats uneinig ist. Auch Joyce und Fitzgerald sind wohl Kandidaten auf die Urheberschaft. Wobei es natürlich nicht darum geht, besoffen zu schreiben, sondern sich – symbolisch – der Ekstase des Geschichtenerzählens hinzugeben und währenddessen nicht zu viel zu analysieren und in Frage zu stellen. Just write, motherfucker. Nach dem magischen Wort ENDE lasse ich das Manuskript ein paar Tage liegen, um Abstand zu gewinnen, und lese es dann von Anfang an. Und hoffe und bange, dass die Ü400 Seiten irgendwie Sinn machen. Am Rande: Ich lasse während des Schreibens eines Romans niemanden lesen, was ich geschrieben habe, um abschätzen zu können, ob es „gefällt“. Beim Schreiben ist es mir komplett egal, ob das Geschriebene später den Lesern gefallen und es „ankommen“ wird. Wenn ich mich in meinem Leben jemals nach Meinungen von außen gerichtet hätte, hätte ich sehr wahrscheinlich keinen meiner Romane zu Ende schreiben können. Und wäre in meinem Leben auch ganz sicher nicht da, wo ich jetzt bin.
Ende August 2022: Deadline um eine Woche überzogen
Internes Lektorat beendet. Endfassung an den Verlag gemailt. Was jetzt noch fehlt: Klappentext, Danksagungen und Cover. Kleinkram. Die „Abenteuerreise Roman No. 4“ ist zu Ende. Auch wenn das Lektorat meines Verlages noch aussteht. Aber das wird easy im Vergleich zum Höllenritt der letzten Wochen und dem Erfinden des neuen Endes. Ich bin rechtschaffen erledigt. Aber auch glücklich. Mein „Baby“ wird in knapp zwei Monaten das Licht der Welt erblicken! Und es wird die Leser in eine gar nicht so weit entfernte Vergangenheit mitnehmen, die aber dennoch eine komplett andere Zeit und Welt ist. Eine Welt, in der sich mein Protagonist erstmal neu orientieren und zurechtfinden und vor allem komplett neu erfinden muss. Auch wenn er diese Zeit aus eigener Erfahrung kennt. Und irgendwann wird ihm bewusst, dass er ziemlich genau vier Monate Zeit hat, um die Liebe seines Lebens vor dem Tod zu retten, die damals bei der Flugtagkatastrophe von Ramstein 1988 ums Leben kam. Problem: Er ist 53 und nicht mehr 23, wie sein „jüngeres Ich“ und seine damalige große Liebe, denen er beiden in dieser ‘neuen Zeitschiene’ begegnet. Und die ticking clock bis zum Flugtag 1988 tickt …
Der Inhalt von Mathias Aichers „1988“ in Kurzform
2018: Der 53-Jährige Schriftsteller und Ex-Musiker Michael Bach findet sich plötzlich im Jahr 1988 wieder. Vier Monate vor der Flugtagkatastrophe in Ramstein, bei der Aimee, die Liebe seines Lebens, starb. Könnte er sie dreißig Jahre danach vor dem Tod retten? Und vielleicht sogar den Flugtag 1988 verhindern? Aber dazu müsste er Aimee neu kennenlernen. Und sein jüngeres Ich als Nebenbuhler ausstechen.
Mehr zu Mathias Aicher
Weitere Werkstattberichte für Sie: