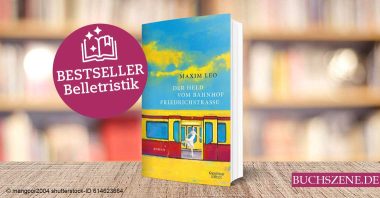© Tortoon shutterstock-ID:519992464
Mit der Arbeit an „Der stumme Bruder“ beginne ich am Geburtstag von Poe
Mit meinem zweiten Kriminalroman „Der stumme Bruder“ beginne ich, als das Jahr 2016 ganz am Anfang steht. Von diesem Titel weiß ich zu dem Zeitpunkt noch nichts, ebenso wenig von seiner konkreten Gestalt, allen Freuden und Kämpfen um dieses künftige Projekt. Nur, dass dieser 17. Januar der Geburtstag von Poe und Highsmith ist – was für Paten an diesem Tag!
Noch gibt es nur mich und eine ungefähre Vorstellung von der Geschichte
Meine Euphorie rührt nicht allein aus dieser erfreulichen wie zufälligen Übereinstimmung – allem Anfang wohnt ein Zauber inne und der hat vor allem damit zu tun, dass der Schreibtisch leer ist und das Blatt weiß. Noch gibt es keine Papierhaufen und Datenmengen und damit auch keine Zweifel, kein mühseliges Überarbeiten, nur mich und eine ungefähre Vorstellung davon, welche Geschichte ich erzählen will. Und das will ich, weil ich in ihr einen glühenden Kern spüre, genug Authentisches und Bedeutsames, das mich über eine lange Zeit immer wieder anstacheln wird weiter zu machen.
Was verletzt uns? Und macht uns Schmerz zu schlechten Menschen?
Wieder kreise ich in diesem frühen Stadium um die Frage: Was verletzt uns auf die denkbar tiefste Weise und wie schlimm muss ein Schmerz sein, damit er noch nach Jahrzehnten vor sich hin glimmt und jederzeit aufflammen kann, kaum, dass jemand ein Zündholz daran hält? Damals und heute, wie groß sind die Abstände wirklich? Und wenn die Distanzen, gerade die inneren, sich in einem schrecklichen Moment auflösen, Vergangenheit und Gegenwart zusammenfallen, verlieren wir dann nicht doch die Kontrolle über uns, selbst, wenn wir bis dahin beherrscht, angepasst und unauffällig lebten? Und macht uns das zu schlechten Menschen?
Ich habe nicht den Hauch einer Vorstellung, was mich erwartet
Ich sitze also mit Schmetterlingen im Bauch am Schreibtisch, gehe in Gedanken zurück, repetiere, wie ich beim Schreiben des ersten Romans vorgegangen bin und meine sogleich, dass ich diesmal planvoller und beherrschter arbeiten muss, schließlich habe ich – Hurra! – einen Buchvertrag. Und an diesem Tag nicht den Hauch einer Vorstellung, was mich diese Entscheidung kosten wird, und das ist gut so.
Ich beginne mit den Biografien meiner Hauptfiguren
Da ein Roman davon erzählt, wie sich eine Figur an einer Herausforderung abarbeitet, wie sie strauchelt, fällt und sich unter größter Mühe aufrappelt, beginne ich mit den Biografien meiner Hauptfiguren. Das sind zunächst die Ermittler, die ich aus dem ersten Band, „Das Ende des Schweigens“, bereits kenne. Also halte ich fest, wer sie während des letzten Falles geworden sind, wie sie sich durch ihn verändert haben.
Kommissar Michael Herzberg muss sich seiner Vergangenheit stellen
Bei Michael Herzberg geschah das auf die gravierendste Weise, er musste sich seiner Vergangenheit als Häftling in Bautzen II noch einmal stellen und seine Erinnerungen neu bewerten. Seine Ehe überstand diese Revision nicht. Ganz schön viel Veränderung, was für einen Moment die Frage aufwirft, ob das Schreiben von Serien nicht langweilig wird, wenn die Figuren ihr Entwicklungspotential so schnell ausschöpfen.
Historische Veränderungen haben immer etwas Gewaltsames an sich
Ich fahre dennoch fort und stelle fest, dass es mit allen anderen relativ zügig vorangeht, meine Euphorie dauert an. Vielleicht, weil ich schnell ein deutliches Gespür für Magda bekomme, eine alte Frau, meine dritte Perspektivfigur. Sie steht in enger Verbindung zum Opfer, in ihr bildet sich die gesamte Geschichte meines Handlungsortes, eines idyllischen mecklenburgischen Dorfes, von 1945 bis in die Gegenwart, ab. Im Kopf, den Erinnerungen, sogar auf ihrem Körper. Brüche, historische Veränderungen wie die von 1945 oder 1989 haben immer etwas Gewaltsames an sich oder sind von Gewalt begleitet. Kurze und lange Schatten der Geschichte, in ihren Erinnerungen, die der Mordfall nach oben spült, sollen sie aufleben.
Ich verfasse zu allen Szenen einen groben Ablaufplan
Der nächste Schritt sind „fließende Handlungsentwürfe“ (E. George), ich verfasse zu allen Szenen, die es geben soll, einen groben Ablaufplan, komme auf etwa 250 Seiten. Was mir dabei Freude macht, ist meine planlose Herumschreiberei. Am Morgen lege ich einfach los und sehe, was passiert. Und es passiert eine Menge, die Gedanken überschlagen sich geradezu.
Es geht nur ohne Krampf, begreife ich in dieser Zeit
Deshalb liegen rechts oben auf meinen Schreibtisch Stapel früherer Textentwürfe, die nun als Notizpapier Verwendung finden. Denn oft dreht sich das Karussell in meinem Kopf so schnell, dass ich tippe und nebenbei von Hand schreibe, um nichts zu verpassen. Nur selten versuche ich in dieser wilden Phase des Schreibens zu „denken“, über ein Problem nachzugrübeln. Tue ich es doch, strengt es mich ungeheuer an, ich werde ungeduldig und prompt verschränkt mein Gehirn die Arme und sagt: so nicht, nicht mit mir! Und kaum habe ich den Ort der Qual verlassen, mich der Waschmaschine zugewandt oder dem Einkauf oder bin draußen unterwegs, da präsentiert es mir nonchalant die Lösung. Es geht nur ohne Krampf, begreife ich in dieser Zeit, und bin fest entschlossen, mir das gut zu merken.
Ich will dieses stille Land mit dem Fahrrad in die Knochen kriegen
Über all dem vergeht ein halbes Jahr und an einem sonnigen Junitag lasse ich alles stehen und fahre nach Mecklenburg. Mein Fahrrad habe ich natürlich dabei, ich will dieses hügelige und stille Land in die Knochen kriegen, mir das Dorf suchen, in dem meine Geschichte spielen soll. Weil ich meine, dass ein Raum nicht nur eine Kulisse ist, sondern auf subtile Weise Akteur der Geschichte, und nur ein erlebter Raum im Roman erlebbar werden kann.
Das Land schreit: „Ich bin fruchtbar.“ Und ich schreibe den ersten Entwurf
Mein Fahrrad und ich legen also los. Es gibt kaum Verkehr zwischen den Dörfern, ich bin meist allein auf den Straßen. Distanzen rechne ich in der Maßeinheit der eigenen Körperkraft, die mich von da nach dort bringt und nicht weiter. Verlangsamung der Fortbewegung, Verkürzung von Zielen auf das Schaffbare – eine Wohltat. Ich habe dabei genug Zeit, alles anzusehen. Die sanfte, weite Landschaft. Dörfer wie ein langgestrecktes Gähnen, Buchenwälder, soweit das Auge reicht. Feld an Feld, eine satte, reiche Gegend, das ganze Land schreit: Ich bin fruchtbar. Nach ein paar Tagen bin ich ganz voll davon und setze mich mit frischer Energie an den ersten Entwurf des Kriminalromans, der einmal „Der stumme Bruder“ heißen wird.
Es folgen Monate des Schwitzens. Was ich schreibe, begeistert mich kaum
Was folgt, sind Tage, Wochen, Monate des Schwitzens – nicht nur, weil sich der Sommer in die Länge zieht. Was ich schreibe, begeistert mich kaum. Liegt es nur daran, dass erste Entwürfe immer Mist sind, wie schon Hemingway sagte und keinen anderen Sinn haben als einfach nur auf dem Papier zu stehen? Oder etwa an meinem planvollen Vorgehen? Ich sitze nämlich jeden Morgen über meinen Handlungsentwürfen, die schon relativ genau ausgearbeitet sind und spüre zwar, wie sich das Karussell in meinem Kopf dreht, neue Gedanken hinzugedacht werden, aber ohne Schwung, Leidenschaft. Ist die Muse beleidigt, weil ich dem Denken schon zu viel Raum gegeben habe?
Bei meinem ersten Roman war das ganz anders
Ein ganz anderes Vorgehen als beim ersten Roman ist das, fällt mir ein. Damals habe ich einfach drauflosgeschrieben und dann sortiert. Vier Entwürfe sind dabei entstanden, aber ich habe kein einziges Mal den Schwung verloren. Und als ich dann beim letzten Durchgang erlebte, wie sich die Strukturen des Plots erst ausbildeten, konnte ich mich auf eine große Menge an Geschriebenem verlassen, die einfach da war. Der glühende Kern der Geschichte, alle Emotionen der Figuren, die Antriebskräfte ihres Handelns waren ausgearbeitet.
In Schottland geschieht ein kleines Wunder. Krass!
Wie auch immer, ich bin irgendwann fertig und fahre in den Urlaub. Und dort, in Schottland, geschieht ein kleines Wunder: Mir fallen ständig Dinge ein, die ich beim nächsten Entwurf besser machen kann. Das Manuskript arbeitet allein und ungestört vor sich hin, scheint mir und ruft mir zu, wie es werden will. Krass. Natürlich schreibe ich alles auf, um nichts zu vergessen.
Die Gespräche mit lieben Kollegen sind Wasser auf meine Mühlen
Zuversichtlich setze ich mich danach an den zweiten Entwurf und siehe da: Ich komme gut voran und bin schon viel zufriedener. Ich bin beinahe fertig, als die Leipziger Buchmesse stattfindet und ich zum Autorentag gehe. Und ich gehe mit vielen Ideen wieder nach Hause, die Gespräche mit lieben Kollegen sind Wasser auf meine Mühlen. Im Sommer bin ich dann fertig, der Abgabetermin rückt in gefährliche Nähe. Ich darf das Manuskript Gisa zum Lesen geben – ja, ich bin ein Glückspilz!
Was soll die Starre im Nacken? Sitzt da die Angst? Habe ich eine Krise?
Es folgen ein paar Wochen, in denen ich nicht recht weiß, wie es mir nun geht. Und was soll auf einmal diese Starre im Nacken, der verspannte Rücken, was bedeuten die? Sitzt da Angst? Habe ich eine Krise? Will ich eine Pause? Ich lese über die Psychosomatik von Nackenschmerzen: Wem der Nacken weh tut, dem ist der Kopf zu schwer geworden, der war zu wenig im Körper und in der Seele, zwischen diesen muss immer ein Gleichgewicht bestehen. Na so was. Und dann bin ich bis in die Fingerspitzen nervös, als ich Gisa am Telefon habe und sie sagt: Liebe Claudia, wir müssen reden! Und ich bekomme bestätigt, was ich dumpf geahnt habe: fertig ist das noch nicht, einige Fehler müssen ausgebügelt werden. Am erschütterndsten die Frage: wo ist Magda, die doch meine überzeugende dritte Perspektivfigur sein sollte? Ich hatte sie völlig vergessen und das, obwohl sie mir am Anfang so wichtig war, die Beschäftigung mit ihr mich bewegt hat und davon überzeugt, dass sie einen brennenden roten Faden durch die Geschichte spinnen wird.
Wie konnte das passieren? Habe ich zu viel nachgedacht?
Wie konnte das passieren? Weil ich zu viel nachgedacht habe? Und schneller als geahnt fallen mir ihre Szenen ein, so als hätten sie die ganze Zeit füßescharrend auf ihren Einsatz gewartet. Und sie sind gut, sie gefallen mir. Was lerne ich daraus? Mich wieder mehr auf das Bauchgefühl zu verlassen und dem Denken nicht allzu viel Raum zu geben? Zweieinhalb Monate habe ich dafür Zeit, alles einzuarbeiten und den ganzen Roman noch einmal durchzugehen.
Die Veränderung winziger Details bringt das ganze Gebäude ins Wanken
Regelmäßig raufe ich mir die Haare, denn die Veränderung winziger Details kann ganze Gebäude ins Wanken bringen, also bin ich extrem wachsam, schlafe wenig. Sehe jeden Tag auf den Kalender. Wenn doch endlich Dezember wäre … Dann der gereckte Daumen der Lektorin und ich bin froh, auch erleichtert. Einen Tag vor Weihnachten bringe ich endlich die durchgesehenen Druckfahnen zur Post und der Roman fällt von mir ab.
Ein Roman ist die Essenz aller Antworten auf tausende Fragen
Wie fasst man nun zusammen, was einem widerfährt, wenn man an einem Roman sitzt, was tut man da, was bedeutet es? Mein Kopf sagt: Ein Roman ist die Essenz aller Antworten auf tausende Fragen, die eine Geschichte dem Autor stellt. Während ich das schreibe, sitze ich im Zimmer der großen Tochter, die längst ausgezogen ist. Da hängt in hellem Holzrahmen ein Spruch an der Wand. „Do what you love. Love what you do.“
Und ganz am Ende fällt es mir wie Schuppen von den Augen
Ich tue, was ich liebe, stelle ich fest, folge darin einer aus tiefstem Herzen getroffenen Entscheidung, soweit so gut. Aber liebe ich nun auch, was ich tue? Bin ich genug mit dem Herzen dabei, sanft und bestätigend, und nicht nur analytisch und zweifelnd mit dem Kopf? Nach allem, was ich in den letzten Jahren beim Schreiben meiner zwei Kommissar-Herzberg-Romane „Das Ende des Schweigens“ und „Der stumme Bruder“ erlebt habe, fällt mir wie Schuppen von den Augen, dass im zweiten Teil dieses simpel und gefällig klingenden Sinnspruches aus einem Dekorationsgeschäft viel mehr steckt als eine hübsches Wortspiel: nämlich der größere Auftrag und die eigentliche Herausforderung.
Weitere Werkstattberichte und Autoreninterviews für Sie: