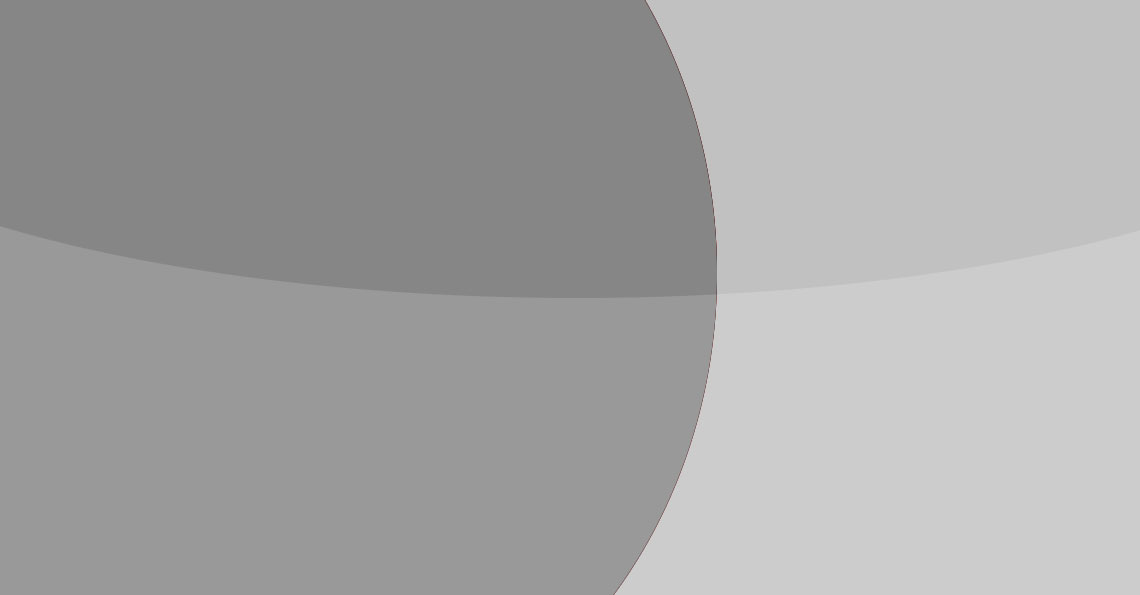Herr Haug, der Untertitel Ihrer Autobiografie lautet „Wie ich den Froschkönig besiegte“. Was hat es mit dem Froschkönig auf sich?
Dabei geht es um ein frühkindliches „Trauma“, denn ich hatte als Kindergarten-Hauptdarsteller im Märchen vom Froschkönig meinen Text vergessen. Der bestand – wie ich Jahre später erfahren habe – lediglich in dem Wörtchen „Quak“! Damit fand damals eine hoffnungsvolle Schauspielerkarriere ihr jähes Ende. Das habe ich mir nun von der Seele geschrieben.
Sie sind 1955 in Stuttgart-Bad Cannstatt geboren. Was war das für eine Kindheit?
Es waren die Nachkriegsjahre, in denen es ganz allmählich aufwärts ging. Aber noch immer hatte nahezu jedes Haus in dem Stuttgarter Stadtteil Luginsland, in dem ich aufgewachsen bin, hinten im Garten seinen Hasen- und Hühnerstall. Und manchmal hat halt sonntags ein Hase im Stall gefehlt … Ansonsten war man sparsam bis zum Abwinken.
Woran machen Sie das fest?
Als Weihnachtsgeschenk gab‘s immer selbergestrickte Socken, die alljährlich im selben Geschenkpapier verpackt waren. Und zum Spielen hatte ich den Quellekatalog. Da habe ich mir dann ausgemalt, dass ich all die schönen Sachen, die da drin abgebildet waren, tatsächlichen besitzen würde. Das war in meiner Phantasie dann auch so – bis der Quellekatalog wieder zugeschlagen wurde – mit dem praktischen Nebeneffekt, dass alle Spielsachen damit auch schon aufgeräumt waren.
Sie haben später eine steile Karriere hingelegt – als Fernsehmann in verschiedenen leitenden Positionen beim SWF und SWR und als Bestsellerautor. Haben Sie als Kind davon geträumt, dass aus Ihnen mal etwas „Besonderes“ werden könnte?
Ich wollte, wie nahezu jeder Bub, Lokführer oder Kapitän werden. Dieses große Ziel habe ich leider nicht erreicht und dann blieb halt nur noch Journalist bzw. Schriftsteller.
Wer war der wichtigste Mensch Ihrer Kindheit und Jugend?
Das war meine Oma väterlicherseits. Die hat mich in meinen ersten Lebensjahren geprägt, denn meine Mutter musste arbeiten – und so hat mir die Oma all die schwäbischen Tugenden versucht, beizubringen: also sparen, schaffen, fleißig und ehrlich sein. Fürs Enkele ist dabei aber ab und zu auch mal ein Schleckeis um zehn Pfennig herausgesprungen.
Sie schwärmen vom Bäcker Hiesinger, dem Bäcker Ihrer Kindheit. Nicht nur wegen seiner Schokoladenbananen, sondern auch wegen seiner schwäbischen Brezeln. Was zeichnet denn eine richtig gute schwäbische Brezel aus?
Die müssen eine ganz knusprige Kruste haben, und wenn man hineinbeißt butterweich zerbröseln. Keinesfalls dürfen sie „kätschig“, also nicht knusprig sein – aber auch nicht so, wie die bayrischen Brezn: das sind ja eher so eine Art Salzstangerln. Doch wie gesagt, es gibt selbst in der ehemaligen Brezelhauptstadt Stuttgart kaum noch einen Bäcker, der eine gute schwäbische Brezel backen kann. Logisch, denn die meisten von denen beziehen ihre Teiglinge ja inzwischen aus Tschechien oder aus Vietnam!
Was bedeutet Ihnen Ihre schwäbische Herkunft, Ihre Heimat?
Das ist schon so eine Art Identifikationsfaktor. Mit dem schwäbischen Dialekt bin ich aufgewachsen, dann aber habe ich irgendwann mitbekommen, dass ich ja zu 50 Prozent auch fränkische Gene habe; meine Mutter stammt aus dem fränkischen Rothenburg ob der Tauber. Also wurde mir damit klar, dass ich in Wahrheit Halbschwabe mit fränkischem Migrationshintergrund bin. Die Gosch isch schwäbisch, aber der Kerle fühlt sich längst auch in Mittelfranken wohl. Im Laufe der Zeit habe ich an vielen Orten gewohnt und an viele denke ich gerne zurück – das alles sind meine kleinen Heimaten. Denn Heimat ist für mich da, wo man sich wohlfühlt und das Herz ein bisschen schneller klopft
Sie erwähnten die Sparsamkeit mit der Sie aufwuchsen. Auch in „Ohne Worte – Wie ich den Froschkönig besiegte“ schildern Sie sehr witzig die Sparsamkeit Ihrer Großeltern. Haben Sie davon etwas mitbekommen?
Logisch. Das ist ja die Schwäbische DNA. Bei mir ist es beispielsweise so: immer dann, wenn ich neue Sachen zum Anziehen kaufen muss, wandern die zunächst noch einige Monate (wenn nicht Jahre) in den Schrank. Denn die alten Sachen sind ja noch gut genug, die müssen erst einmal aufgetragen werden.
Ihre Großmutter war eine resolute Person. Einmal gab es da einen Zwischenfall mit einem Spülbecken-Pinkler …
Das war ein Untermieter, ein so genannter „möblierter Herr“, der aber nachts zu faul war, die Toilette zu benutzen, wenn ihn ein mittleres Bedürfnis geplagt hat. Und da hat er halt ins Waschbecken seines Zimmers gepinkelt – was meine Oma natürlich gerochen hat. Als er‘s nach der ersten gelben Karte nochmal getan hat, folgte sofort die rote Karte und er ist hochkant hinausgeworfen worden. Da gab‘s bei meiner Oma kein Pardon!
„Den nächsten großen Einschnitt in meinem Leben markiert ein gnadenloser Akt der Willkür“, schreiben Sie an einer Stelle Ihrer Biografie. „Das war, als ich im zarten Alter von achteinhalb Jahren auf die Schwäbische Alb verschleppt worden bin.“ Warum war das so einschneidend für Sie?
Weil die Schwäbische Alb damals noch Schwäbisch Sibirien war. Stellen Sie sich vor: als Großstadtkind kommst du da plötzlich in die Pampa, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, wo es eine Schule mit nur zwei Klassen gibt (die jüngeren und die älteren), wo Sie den harten Dialekt nicht verstehen und wo es (im Gegensatz zum milden Stuttgarter Klima) „drei Monate lang kalt und neun Monate lang Winter“ ist.
Sie waren in der Schule kein begnadeter Sänger, aber Sie zettelten 1973 einen Streik an?
Das war der Brezelkrieg. Als der örtliche Bäcker, der die Schule beliefert hat, meinte, seine Brezeln von einem Tag auf den anderen von 15 Pfennig auf 25 Pfennig verteuern zum müssen. Da haben wir von der SMV einen Boykott organisiert und er ist auf seinen Brezeln sitzengeblieben. Danach haben wir über die SMV billigere Brezeln aus einem Supermarkt organisiert: Einkaufspreis 16 Pfennig, Abgabepreis 20 Pfennig. So hat auch die SMV immer was für Schulfeste in der Kasse gehabt und dem Bäcker hatten wir gezeigt, wo der Hammer hängt. Wobei … die Brezeln aus dem Supermarkt haben grauenhaft geschmeckt.
Letztlich war der Brezel-Streik aber der Ausgangspunkt für Ihre spätere Karriere als Journalist.
Ja, damals hatte ich Kontakt zur örtlichen Zeitung und auch zum Fernsehen bekommen, die über uns berichtet haben. Und so bin ich in den Sommerferien mit 16 Jahren zur Zeitung und habe die gefragt, ob sie denn nicht eine Urlaubsvertretung brauchen. Sie haben mir dann eine Polaroidkamera in die Hand gedrückt und ich bin losgezogen. Mein erstes Foto in der Zeitung zeigte das Neubemalen eines Zebrastreifens in Münsingen. Das war der Beginn meiner journalistischen Karriere.
Sie wurden zunächst Lokaljournalist. Haben Sie da auch etwas fürs Leben gelernt?
Und wie: das habe ich später auch allen gesagt, die unbedingt gleich zum Fernsehen wollten: „Wer noch nie in seinem Leben spannend (!) von der Generalversammlung der Hasenzüchter berichtet hat, der weiß nicht, was Journalismus ist. Also bitte: eins nach dem anderen und nicht glauben, man sei was Besseres, nur weil da was über die Mattscheibe flimmert. Lokaljournalismus ist Basisarbeit – im besten Sinne des Wortes – und auch die beste journalistische Schule, die es gibt.
Wie gelang Ihnen der Sprung zum Radio und Fernsehen?
Man strebt ja seltsamerweise weiter und weiter – und ist nie zufrieden. Und als ich dann in Tübingen studiert habe, gab es da das Südwestfunk-Landesstudio. Da habe ich dann Radio gemacht und mir so mein Studium verdient. Später dann musste es natürlich unbedingt Fernsehen sein. Und bereits am ersten Tag dort war ich kreuzunglücklich. Ich dachte: Was für ein Scheißmedium. Denn bei Fernsehen ist ja das Bild die Nummer 1 und der Text muss sich unterordnen. Ich aber war und bin immer jemand gewesen, dem das Wort das Wichtigste war. Also bin ich dreimal vom Fernsehen wieder weggegangen – ein ständiges Hin und Her!
Sie haben viele Prominente interviewt. Unter anderem Helmut Kohl. Da waren Sie ein bisschen frech…
Beim 150-jährigen Jubiläum des „Schwarzwälder Boten“ in Oberndorf gab es eine große Feier. Bundesweite Prominenz ist da angereist – unter anderen auch der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl. Und ich musste live über die Feier im Radio berichten. Aber was? Die hatte noch gar nicht begonnen, als ich schon auf Sendung war. Also habe ich der Prominenz vorher die immergleiche Frage gestellt: „Was ist das als Politiker für ein Gefühl, bei einer Zeitung zu feiern, die einen eventuell schon morgen in einem Kommentar wieder in die Pfanne haut?“ Alle haben gegrinst und mir mehr oder minder geistreiche Antworten gegeben, bloß Kohl nicht. Der hat mich mit einem vernichtenden Blick fixiert, dann den Kopf geschüttelt und gemeint: „Was ist denn das für eine Frage?!“ Dann hat er mich einfach stehen lassen. Nun gut dachte ich – selber schuld: Denn genau diese blöde Antwort von Kohl habe ich dann auch gesendet.
Was war Ihr schrägstes Erlebnis als Journalist?
Sicherlich meine Reportage am Tag nach den Selbstmorden in Stammheim 1977. Da hatten sie mich als blutjungen Reporter mit 22 Jahren hingeschickt, um live für alle Sondersendungen zu berichten. Und damals habe ich dann gelernt: Die Musik spielt die hochpolitischen Ereignisse niemals dort, wo das Geschehen stattgefunden hat. Also nicht vor dem Gefängnistor von Stammheim, sondern – damals noch – in Bonn und in Stuttgart. Aber eine Reportage habe ich dennoch machen müssen: fünf Minuten heiße Luft – mehr war da nicht. Aber die verantwortlichen Redakteure waren zufrieden: Hauptsache, wir hatten einen Hauch von Pseudoaktualität über den Sender geblasen.
Einmal haben Sie für eine Sendung auf Burg Wildenstein aus Versehen den falschen bekannten Sänger engagiert. Wie war das?
Da hatte ich bei einer Fernsehsendung einen Musiker – es war Thomas Anders – kennengelernt, den ich als den Kompagnon von Dieter Bohlen bei „Modern Talking“ identifiziert hatte. Sofort habe ich ihn für eine Radiosendung auf der Burg Wildenstein einige Wochen später engagiert. Per Handschlag haben wir‘s fix gemacht – und gekommen ist dann zu unserem größten Schreck aber bloß Jürgen Drews, der damals ziemlich weit unten war – aber so ähnlich ausgeschaut hat, wie Thomas Anders. Kurz danach ist er dann König von Mallorca geworden.
Und dann folgte Ihr Abschied vom Fernsehen – mit einem ziemlichen Eklat. Wie war das?
Ich war schon lange nicht mehr glücklich mit diesem Medium, das sich ja inzwischen zur größten Verdoofungsmaschine im Bereich des Journalismus entwickelt hat. Deshalb habe ich nebenher Krimis geschrieben; einen mit dem beziehungsreichen Titel „Höllenfahrt“. Darin habe ich auf sechs (!) Seiten einen fiktiven „Spätzlessender“ in Stuttgart beschrieben, über dessen einst herausragende journalistische Qualitäten sich längst der Mehltau von Trägheit und Angepassheit hernieder gesenkt habe. Und ratzfatz war ich draußen: fristlos gekündigt! Später musste mich der SWR laut Gerichtsbeschluss dann wieder einstellen – und als ich wieder drin war, habe ich gesagt: So, jetzt habe ich der Intendantenwillkür gezeigt, wo der Hammer hängt. Jetzt gehe ich – und zwar aus freien Stücken!
Konnten Sie nach Ihrem Entschluss, den SWR zu verlassen und sich als freier Autor durchzuschlagen, gut schlafen?
Ja, dank meiner Bestseller „Niemands Tochter“ und „Niemands Mutter“ schon. Auch, wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehbeamtengehalt natürlich schon üppig gewesen ist, und vor allen Dingen regelmäßig kam. Das ist bei einem freien Schriftsteller ja schon ein bisschen anders. Aber seitdem bin ich ein freier Mensch und das ist das Wichtigste. Meine Chefs sind jetzt meine Leserinnen und Leser!
Würden Sie aus heutiger Sicht etwas anders machen?
Bälder den Mund aufmachen und nicht darauf setzen: das wird schon wieder werden. Wird es nie – es wird eher immer schlimmer. Vor allem bei den Besetzungsspielchen in den Anstalten hätte ich öfter und lauter sagen sollen, dass das nicht geht, wenn wieder einmal anstelle eines guten Kollegen so eine Flasche eingestellt worden ist, die aber das notwendige Vitamin B mitgebracht hat. Das Resultat dieser Personalpolitik können wir nun tagtäglich erleben und erleiden.
Ihr Buch „Niemands Tochter“ über Ihre Großmutter wurde dann Ihr größter Erfolg. Dabei wollten Sie dieses Buch überhaupt nicht schreiben …
Meine Mutter wollte unbedingt, dass ich ein Buch über meine fränkischen Großeltern schreibe. Ich aber sagte immer, das interessiert doch keine Sau! Die Leute waren bitterarm, mein Großvater Tagelöhner, oft arbeitslos, wen soll so eine Biographie denn interessieren? Aber meine Mutter hat nicht locker gelassen und irgendwann hatte ich dann den Push bekommen, als sie mir die Geschichte erzählte, wie meine Großmutter als sechs Wochen altes Wickelkind von ihrer Mutter hatte weggeben werden müssen – und diese Frau musste davon ausgehen, dass sie ihre kleine Maria niemals mehr wiedersieht. Da habe ich zu schreiben begonnen – und: wow! Mittlerweile ist das Buch in der 32. Auflage! Auch Mütter haben manchmal recht … Sie hat mich jetzt ja auch zu meinem neuen Buch „Ohne Worte – Wie ich den Froschkönig besiegte“ gezwungen. Das wollte ich eigentlich auch nicht schreiben. Wenn das dann denselben Weg wie „Niemands Tochter“ nimmt, dann war‘s ja richtig mit der mütterlichen Nerverei.
Ist „Niemands Tochter“ auch dasjenige Ihrer Bücher, das Sie am liebsten mögen?
Ein guter Vater liebt alle seine Kinder! Aber das Jüngste von ihnen natürlich irgendwie immer noch ein bisschen mehr. Ist ja noch so winzig und entwicklungsfähig.