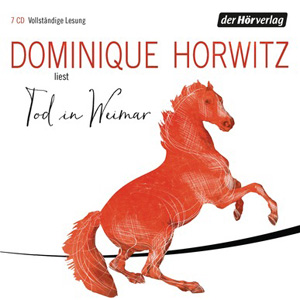Wie beschreiben Sie selbst Ihren Protagonisten Roman Kaminski?
Er ist auf jeden Fall viel interessanter, als ich es bin, denn er ist zu einhundert Prozent Dominique Horwitz und zu einhundert Prozent das, was Dominique Horwitz gern sein würde. Kaminski als Mister Zweihundertprozent ist viel diskreter und viel zarter als ich. Er ist viel gebildeter, er kann Klavier spielen und, und, und. Alles, was ich mir erträume, kann er nun für mich erleben, denn er lebt ja nun wirklich – im Roman.
Im Buch kutschiert Kaminski Touristen durch Weimar. Diese Figur kommt uns bekannt vor – aus dem Weimarer Tatort. Ist das Zufall? Wie entsteht so eine Figur?
Als ich nach Weimar zog, fiel mir auf, wie wenig diese Stadt medial präsent ist. Es gibt sie nur für den bildungsbewussten Kulturbürger, der in Scharen anreist, und die Deutsch-Leistungskurse. Oder wenn die Bibliothek abbrennt. Keine Stadt, von der man sagen würde, da will ich hin, da will ich leben. Denn was Weimar ausmacht, ist altes Gemäuer, Geschichte, Tradition und dazu die beiden Aufklärer, die sich nicht trauen, Händchen zu halten. Also wollte ich eine Figur erfinden, die vom Damals erzählt, aber mit den Lesern über das Heute nachdenken kann. Mein Kutscher war geboren. Dass ich im Weimarer Tatort einen solchen Kutscher spielen durfte, ist reiner Zufall. Mein Kutscher Roman Kaminski soll von mir, meinem Leben, meinen Gedanken, meiner Liebe, vom Theater, dem Altern – und eben auch von Weimar erzählen.
Das Seniorenheim in Ihrem Roman, die „Villa Gründgens”, in dem Kaminski widerwillig als Hausmeister einspringen muss, ist in seinen ungemein kuriosen Details Ihre Erfindung …
Selbstredend. …
aber die „Marie-Seebach-Stiftung“, Deutschlands einziges Altersheim für Bühnenkünstler, gibt es wirklich in Weimar.
Ja, ich habe mich von der Stiftung inspirieren lassen, aber mein Altenheim und seine Bewohner sind reine Erfindung (lacht): Ich bin sicher, im Stift lebt man länger und gesünder. In der „Villa Gründgens” geht es aber womöglich anarchischer, chaotischer und frecher zu. Und auch die Erotik spielt dort eine tragende Rolle. Wie Sie sehen, habe ich mich noch nicht entschieden, wo ich mich im Alter niederlassen werde.
Dank der probierenden Schauspielertruppe in der „Villa Gründgens”liest sich Tod in Weimar auch als Schauspieler-Satire, inklusive aller möglicher Schrullen und Allüren. Gibt es einen anstrengenderen Rentner als einen ehemaligen Schauspieler?
(Lacht.) Es gibt, glaube ich, keinen anstrengenderen Rentner als einen alten Schauspieler oder eine alte Schauspielerin. Ebenso wie einen alten Musiker oder Schriftsteller oder Chansonnier … Alle Menschen, die berufsbedingt nach außen gehen müssen und es geschafft haben, sind, glaube ich, im Alter wahnsinnig anstrengend. Der Erfolg bleibt aus, das aufregende Leben bleibt aus, das Publikum bleibt aus. Was bleibt, sind Rückenschmerzen und Verdauungsstörungen. Ich fürchte mich vor dem eigenen Vergreisen. (Schmunzelt.) Ich hab vor allem Angst für meine Frau, die das alles wird aushalten müssen!
Von Brecht zu Brel, von Mendelssohn Bartholdy zu Franz Kafka, vom Filmset aufs Theater und jetzt auch noch aufs Lesungspodium … Muss man sich Dominique Horwitz denn nun als schreibenden Schauspieler vorstellen? Oder lieber als singenden Romancier?
Ebenso wie ich ein singender Schauspieler bin, bin ich auch ein schreibender Schauspieler. Ich hoffe, das merkt man dem Buch an. Es lebt von den Figuren und der Situationskomik. Und den Dialogen. Dieses Buch speist sich aus meinen Theatererfahrungen, meiner Musikalität und ist dabei nicht ganz zufällig eine große Liebesgeschichte.
Sie haben Tod in Weimarselbst als Hörbuch eingelesen. Sind Sie denn nun Freunde geworden: das Studio und Sie? Und sind Sie Freunde geblieben: Ihr Roman und Sie?
Es fühlt sich sehr eigentümlich an, etwas, das einem so vertraut und so nah ist wie ein eigener Text, laut vorzulesen. Um ehrlich zu sein, habe ich mich etwas geziert. Doch der Verlag meinte, das Buch sei dermaßen Dominique Horwitz, dass ich das selbst einlesen müsse. Ich bin jetzt sehr froh darüber, denn ich habe gespürt, wie viel Persönliches ich noch beim Sprechen einfließen lassen konnte. Was zwischen den Zeilen geschrieben war, wofür ich keine Worte gefunden habe. Für mich eine große Erfahrung.