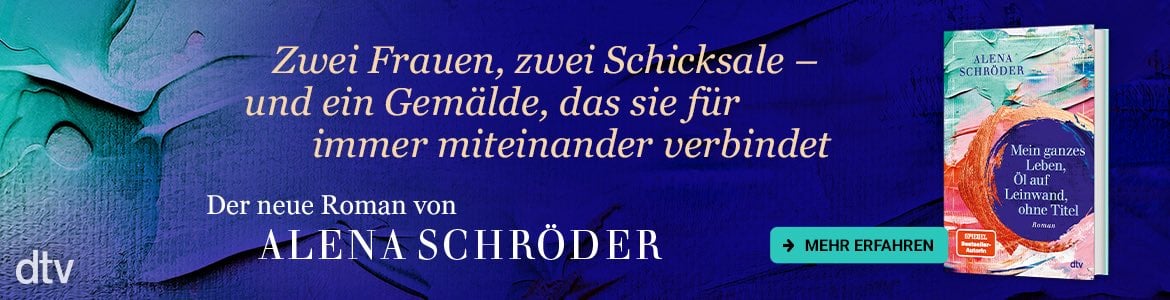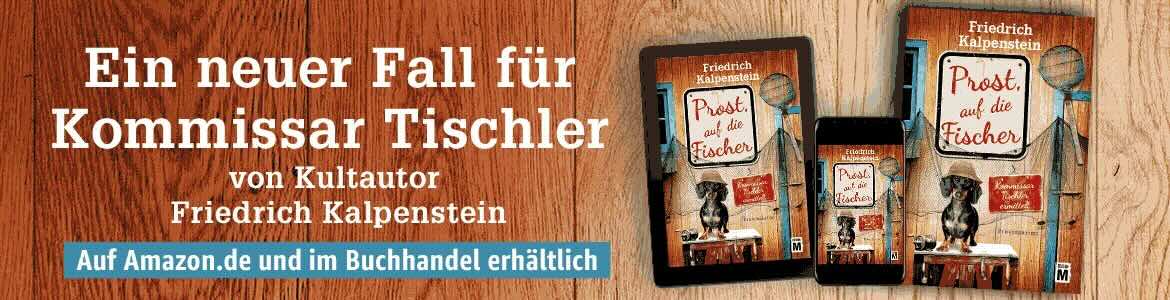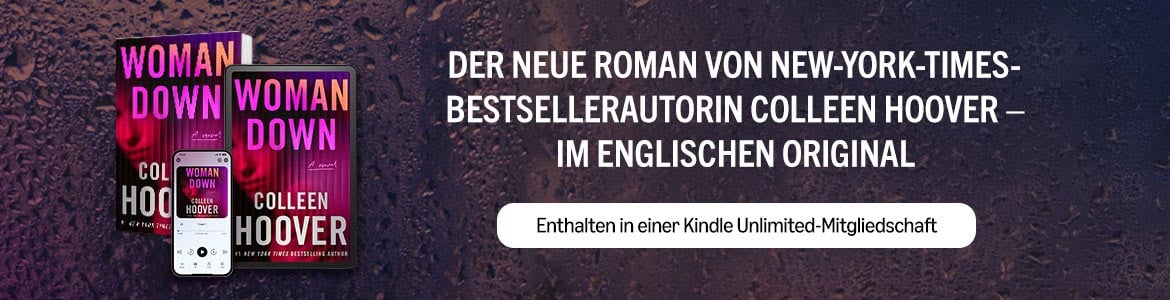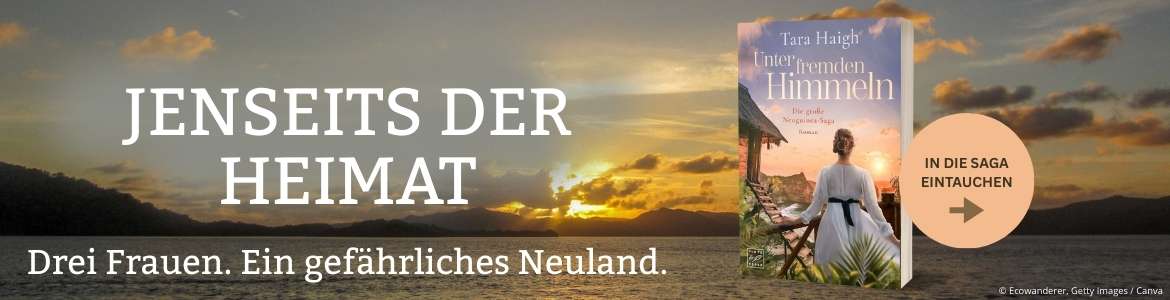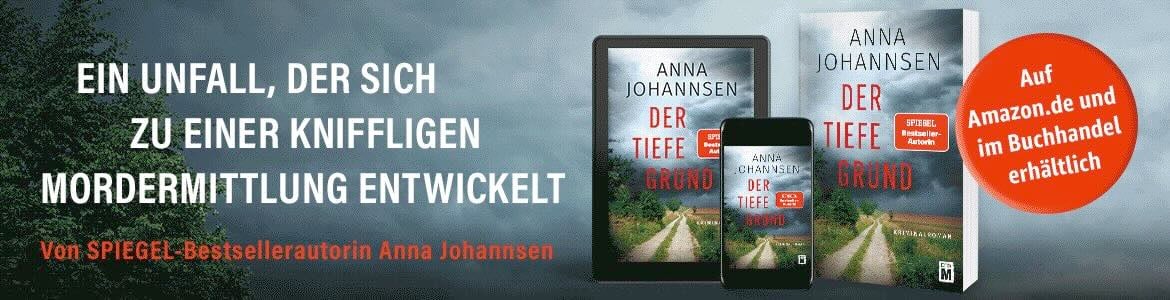Und mit welchen Ritualen und Marotten befeuern andere Arbeiter des Geistes ihr kreatives Pensum? Jenes Künstlertum, das nach
Thomas Mann
auf der „tiefen Instinktverschmelzung von Zucht und Zügellosigkeit“ beruht? Für
Dörte Hansen
startet der Tag jedenfalls freihändig. Sie steigt, in jeder Hand eine Tasse Kaffee, morgens eine steile Leiter hoch. Unters Dach. Wo sie schreibt und das Alte Land vor Augen hat.
Isabel Allende
beginnt jeden ihrer Romane an einem 8. Januar. Ein Ritual, seit sie an diesem Tag aus ihrer Heimat Chile den Anruf erhielt, dem sie die Idee zu ihrem Roman-Erstling Das Geisterhaus verdankt. Für
Jane Austen
war „das Schreiben unmöglich, wenn mir Hammelfleisch und Rhabarber durch den Kopf geistern“. Ihre Schwestern übernahmen einen Großteil der Hausarbeit. Geschrieben wurde im Wohnzimmer, während sich Mutter und Schwestern dort der Handarbeit widmeten. Und die Männer?
Jean-Paul Sartre
dröhnte sich mit Unmengen von Kaffee, Alkohol, Nikotin und täglich bis zu 20 Corydrane voll, einem hochgefährlichen Mix aus Amphetaminen und Aspirin. Und schrieb pro eingeworfener Tablette ein bis zwei Seiten. Hingegen wechselte das laut Selbsteinschätzung „methodische Arbeitstier“
George Simenon
während der Arbeit an einem Maigret-Roman zwar niemals die Kleidung, schaffte dafür aber bis zu 80 Schreibmaschinenseiten pro Sitzung. Am wildesten trieb es wohl der koffeinsüchtige
Honoré de Balzac,
dessen Arbeitsethos perfekt in unsere Zeit gepasst hätte: „Ob ich nun an der Arbeit sterbe oder etwas anderem, spielt keine Rolle.“
Und Agatha Christie?
Besaß nicht mal einen Schreibtisch. Warum auch? Ihr Zeitgenosse
William Somerset Maugham,
einer der meistgelesenen Schriftsteller seiner Zeit, hatte schon richtig erkannt: „Es gibt drei Regeln, wie man einen Roman schreibt. Leider weiß niemand, wie sie lauten.“ Deswegen braucht es keinen Schreibtisch. Sondern Willen. Talent. Eventuell Kaffee. Und auch der Geist darf ruhig rauchen. (kdm)